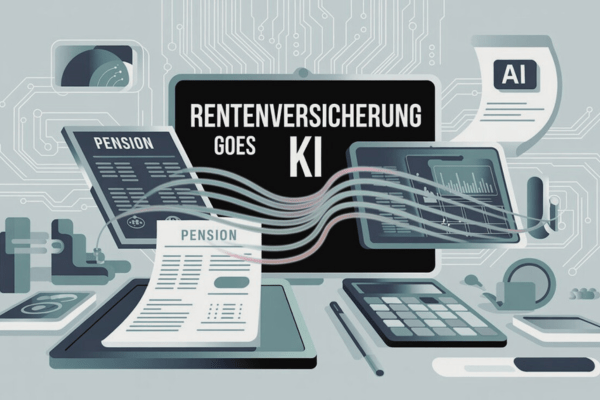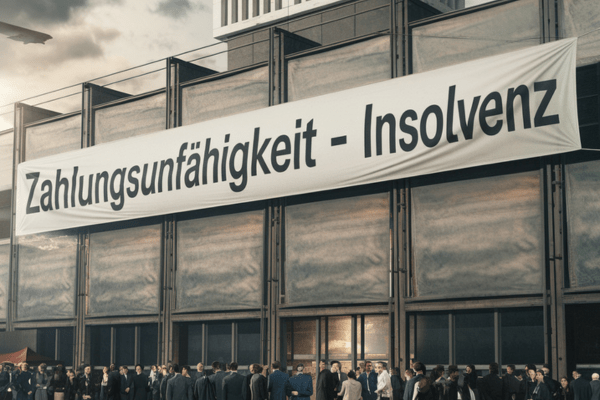Ob Dienstrad, Jobticket oder andere Sachleistungen – Gehaltsverzicht und Entgeltumwandlung sind längst Alltag in vielen Unternehmen. Beide Seiten profitieren von Vorteilen bei Steuern und Sozialabgaben. Doch damit diese Modelle rechtssicher funktionieren, gilt es arbeitsrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Spielregeln einzuhalten. Dieser Beitrag zeigt, worauf es ankommt – und wie Fehler vermieden werden.
Was ist Gehaltsverzicht? Das Prinzip einfach erklärt
Beim Gehaltsverzicht verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Bruttogehalts und erhält dafür eine Sachzuwendung, zum Beispiel ein Dienstrad. Das monatliche Bruttogehalt wird um die Leasingrate reduziert, sodass sich auch Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge verringern – beide Seiten sparen.
Beispiel:
Die Leasingrate für ein Dienstrad beträgt 70 €. Durch die geringeren Steuer- und Sozialabgaben reduziert sich der tatsächliche Eigenanteil für den Arbeitnehmer häufig auf rund 35 € monatlich. Nach Ende des Leasingvertrags steigt das Bruttogehalt wieder auf das ursprüngliche Niveau.
Das Modell funktioniert ähnlich bei Jobtickets, Hardware-Leasing oder anderen Sachbezügen.
Vorteile: Warum lohnt sich das Modell für beide Seiten?
- Arbeitnehmer zahlen weniger Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge (bis zur Beitragsbemessungsgrenze)
- Arbeitgeber sparen ihren Anteil an Sozialversicherungsabgaben
- Mit Ablauf des Leasingvertrags entfällt die Gehaltsumwandlung und das Gehalt wird wieder vollständig ausgezahlt.
Hinweis:
Endet die Entgeltumwandlung, etwa nach Ablauf eines Leasingvertrags, ist eine Anpassung des Arbeitsvertrags notwendig, damit das Bruttogehalt wieder korrekt ausgewiesen und gezahlt wird.
Wichtig zu wissen:
Bei der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) müssen Arbeitgeber ihre SV-Ersparnis seit 2019 an Mitarbeiter weitergeben. Für andere Gehaltsverzichtsmodelle (wie das Dienstrad) gilt das bislang nicht verbindlich – hier entscheidet die individuelle Regelung im Arbeitsvertrag!
Arbeitsrechtliche Voraussetzungen: Was muss im Vertrag geregelt sein?
Damit der Gehaltsverzicht auch sozialversicherungsrechtlich anerkannt wird, sind folgende Punkte unverzichtbar:
- Zulässigkeit: Der Verzicht muss arbeitsrechtlich erlaubt sein.
- Schriftform: Die Vereinbarung muss schriftlich erfolgen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 Nachweisgesetz).
- Künftiges Entgelt: Die Regelung darf sich nur auf zukünftiges Gehalt beziehen – rückwirkende Änderungen sind unwirksam.
Darüber hinaus müssen Mindestlohn, tarifliche Untergrenzen und ggf. Equal-Pay-Regeln bei Leiharbeit eingehalten werden.
Hintergrund:
In der Sozialversicherung gilt das „Entstehungsprinzip“ – entscheidend ist, was im Vertrag steht. Im Steuerrecht dagegen zählt das „Zuflussprinzip“, also was tatsächlich ausgezahlt wird. Deshalb ist eine korrekte arbeitsvertragliche Formulierung absolut zentral.
Risiko bei fehlender oder fehlerhafter Vereinbarung
Was passiert, wenn die Verträge nicht stimmen?
Bei Betriebsprüfungen der Deutschen Rentenversicherung werden Arbeits- und Zusatzverträge genau geprüft. Fehlt eine wirksame Regelung zum Gehaltsverzicht, werden die (eigentlich gesparten) Sozialversicherungsbeiträge nacherhoben – plus Zinsen und Säumniszuschläge. Das kann für Unternehmen teuer und rückwirkend sehr belastend werden.
Fazit & Empfehlung
Unternehmen, die Entgeltumwandlung oder Gehaltsverzicht anbieten möchten, sollten ihre Arbeitsverträge und Zusatzvereinbarungen unbedingt korrekt und rechtssicher gestalten. Nur so lassen sich böse Überraschungen bei der nächsten Sozialversicherungsprüfung vermeiden.
Klare Regeln sorgen für Sicherheit auf beiden Seiten – und ermöglichen, dass innovative Modelle wie Dienstrad-Leasing oder Jobticket wirklich zum Vorteil für Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden.
Brauchen Sie Unterstützung im Bereich Payroll? Wollen Sie Ihre Prozesse rechtssicher aufstellen?
Dann kontaktieren Sie mich gerne für ein unverbindliches Erstgespräch!