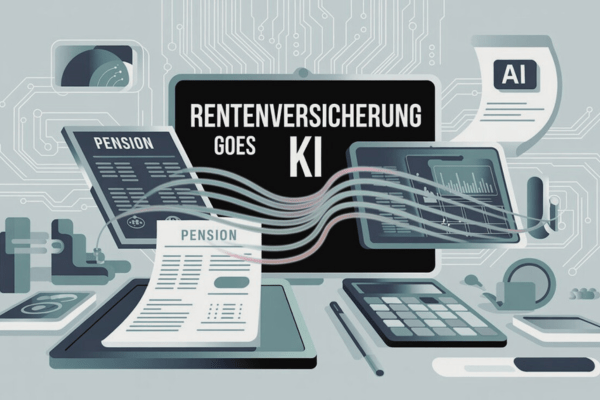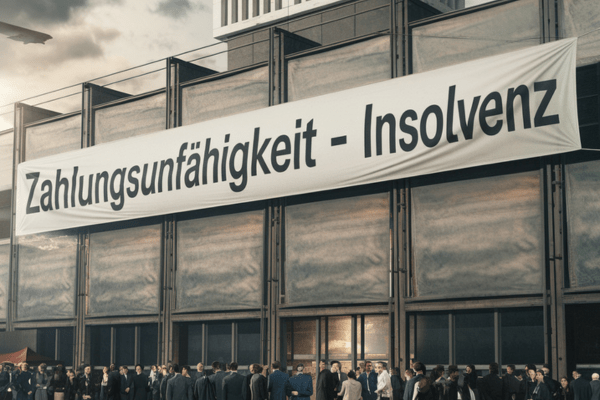Die Pflegeversicherung ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Sozialsystems. Sie wurde 1995 als fünfte Säule der Sozialversicherung eingeführt und soll die Risiken bei Pflegebedürftigkeit absichern. Seitdem hat sie einige Änderungen erfahren, um sich an die gesellschaftlichen und demografischen Herausforderungen anzupassen.
Deutsche Pflegeversicherung im internationalen Vergleich
Zu den Ländern mit den umfassendsten und nutzerfreundlichsten Pflegesystemen gehören Dänemark, Schweden und die Niederlande. Gleich danach folgt Deutschland mit guten Pflegeleistungen.
Allerdings beschränkt sich das deutsche System auf Leistungen bei erheblichem Pflegebedarf (Pflegestufen) und im Gegensatz zu anderen Ländern sind erhebliche Zuzahlungen – bis zu 50% der Kosten durch den zu Pflegenden – möglich.
Versicherungspflicht
In Deutschland besteht für Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert sind, automatisch auch eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Privat Krankenversicherte müssen eine private Pflegeversicherung abschließen. Auch hier gilt die Versicherungspflicht in beiden Zweigen. Die Leistungen der privaten Pflegeversicherung unterscheiden sich nicht im wesentlichen von der gesetzlichen, aber kann natürlich etwas variieren, da der Versicherungsnehmer über die versicherten Leistungen selbst bestimmt.
Finanzierung
Die Pflegeversicherung wird durch Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern (paritätisch) finanziert, wobei sie eine sogenannte Umlageversicherung ist. Das bedeutet, dass die aktuellen Beiträge der Versicherten direkt zur Finanzierung der Leistungen für Pflegebedürftige verwendet werden. Da die Bevölkerung altert und die Pflegebedürftigkeit zunimmt, ist genau diese Art der Finanzierung ein Problem. Auf immer weniger Beitragszahler, kommen immer mehr Leistungsempfänger.
Beitrag und Beitragssatz
Die Beiträge der Versicherten (Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteil) werden monatlich an die gesetzlichen Krankenkassen abgeführt. Die Krankenkassen transferieren diese dann in Pflegekasse, die Teil der GKV ist.
Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung lag bei der Einführung 1995 bei 1,0 %. Der aktuelle Beitragssatz unterscheidet Beitragszahler mit und ohne Kinder. Der Beitragssatz für Kinderlose liegt aktuell bei 4,0%. Der normale Beitragssatz bei 3,4% (mind. 1 Kind).
Seit dem 1. Januar 2023 gilt eine neue Staffelung der Beiträge nach der Anzahl der Kinder. Versicherte mit einem Kind zahlen den normalen Beitrag von 3,4%. Ab zwei Kindern reduziert sich der Beitrag je Kind um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Diese Regelung soll die Erziehungsleistung von Familien honorieren und die Finanzierung der Pflegeversicherung gerechter gestalten.
Leistungen
Die Pflegeversicherung unterscheidet zwischen ambulanten und stationären Leistungen. Bei der ambulanten Pflege gibt es Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen oder Pflegesachleistungen durch professionelle Pflegedienste. Die Höhe der Leistungen richtete sich zunächst nach der Pflegestufe (1-3), seit 2017 nach dem Pflegegrad (1-5). Bei stationärer Pflege übernimmt die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten für die Pflege in einem Pflegeheim.
Zudem ist die Pflegekasse für das sog. Pflegeunterstützungsgeld zuständig. Dies ist eine Lohnersatzleistung für Arbeitnehmer, die für die Pflege eines nahen Angehörigen kalenderjährlich bis zu 10 Tagen unbezahlt von der Arbeit freigestellt werden können.
Bisherige Änderungen
- 2008: Einführung der Pflegestufe 0 für Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz
- 2015: Einführung des Pflegestärkungsgesetzes I mit Leistungsverbesserungen
- 2017: Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und den Pflegegraden 1-5
- 2019: Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III mit Leistungsausweitungen und Beitragssatzerhöhung
Geplante Änderungen 2025
Ab 2025 soll der Beitragssatz zur Pflegeversicherung weiter steigen, da die derzeitige Finanzierung nicht gesichert ist. Zudem soll ein Pflegevorsorgefonds eingeführt werden, um den demografischen Wandel besser abzufedern. Eine Erhöhung auf bis zu 6% des Bruttoeinkommens könnte möglich sein.
Fazit
Das Thema Pflege wird nicht nur finanziell immer brisanter, auch die Arbeitgeber müssen sich auf eine verstärkte Inanspruchnahme von Pflegezeit und die damit verbundenen Ausfallzeiten einstellen.
Die Pflegeversicherung ist massiv unterfinanziert. Es bleibt abzuwarten, ob die für 2025 geplanten Maßnahmen ausreichen, um eine gute und bezahlbare Pflege für alle Bürger zu gewährleisten und die Finanzprobleme der Pflegekassen zu lösen. Eine ständige weitere Erhöhung der Beiträge für Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber kann aus meiner Sicht nicht die Lösung sein.
Auch Steuerzuschüsse werden zunehmend als notwendig erachtet, um die Finanzierung langfristig zu sichern. Gerechterweise sollten Arbeitnehmer, die nach längerer privater Krankenversicherung in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung zurückkehren, mit Beitragszuschlägen belastet werden. Denn sie erhalten sofort Leistungen aus dem gesetzlichen System, aber ihre Beiträge der letzten Jahre fehlen im System.