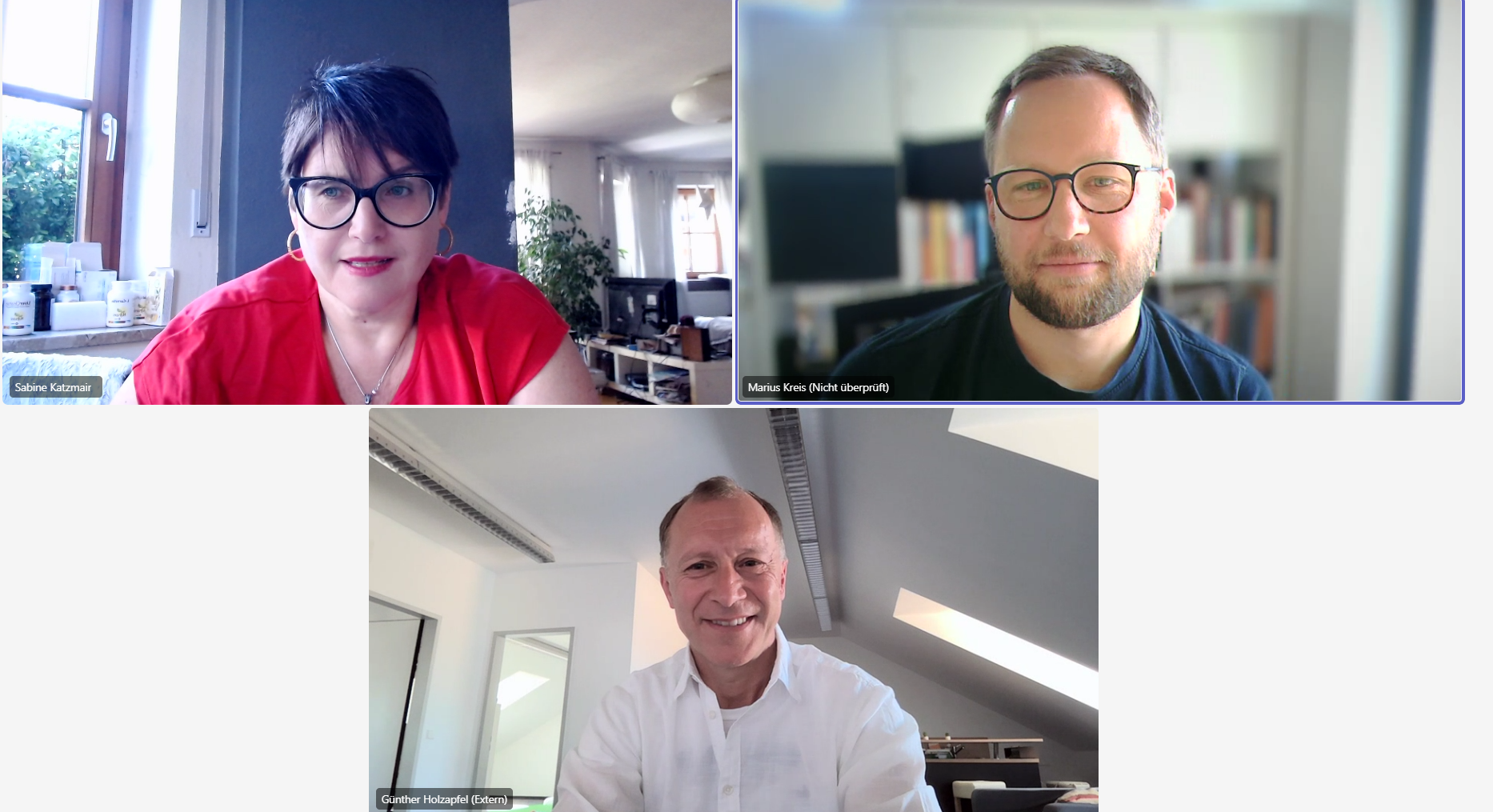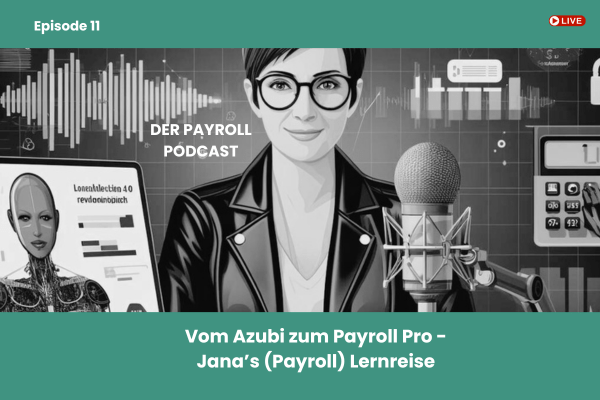Die Besteuerung von Firmenwägen ist in der Lohnsteuerprüfung sowie in der Finanz-Rechtssprechung stets ein beliebtes Thema. In der Gehaltsabrechnung heißt es hier immer auf dem neuesten Stand zu sein, um bei der Umsetzung alles richtig zu machen. Gerade eben wurde wieder ein neues Urteil entschieden. Bei einem erteilten Fahrverbot aus gesundheitlichen Gründen liegt kein geldwerter Vorteil vor und somit darf auch keine Lohnversteuerung vorgenommen werden. (Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 24.01.2017 – 10 K 1932/16 E –) .
Zum Hintergrund: Darf ein Arbeitnehmer seinen Firmenwagen auch privat nutzen, entsteht ein sog. geldwerter Vorteil, der monatlich in der Gehaltsabrechnung versteuert werden muss. Für die Besteuerung (bei Anwendung der 1%-Methode) des Firmenwagens ausschlaggebend, ist stets die Möglichkeit der Nutzung, d.h. der Firmenwagen steht dem Mitarbeiter zur Verfügung und er könnte diesen privat nutzen. Dieser geldwerte Vorteil wird dann monatlich mit 1% des Bruttolistenpreises versteuert. Es ist stets ein voller Monat zu versteuern, auch wenn der Mitarbeiter, das Auto nicht den ganzen Monat nutzen konnte; z.B. erstmalige Übernahme des Fahrzeugs erst am 30.04. Das Lohnsteuerrecht sieht hier leider keine anteilige Versteuerung vor.
Auch in meiner Projektpraxis hatte ich letzthin einen interessanten Fall zu diesem Thema: Ein neuer Mitarbeiter mit Eintritt zum 01.03. möchte gerne seinen bisherigen Firmenwagen weiterfahren. Der Leasingvertrag soll vom neuen Arbeitgeber übernommen werden. Leider kann die Übernahme des Leasingvertrags erst zum 01.04. erfolgen. Der Mitarbeiter nutzt jedoch das Auto weiter wie bisher, allerdings geschäftlich im März schon für den neuen Arbeitergeber, der auch die private Nutzung erlaubt.
Problem in Gehaltsabrechnung: Wo soll die Versteuerung des geldwerten Vorteils für den Monat März erfolgen?
Nutzungsgewährung (Kostenübernahme des Fahrzeugs) und Nutzung fallen in diesem Fall auseinander – Der alte AG trägt die Kosten, die Nutzung (geschäftlich wie privat) des Wagens erfolgt jedoch im März schon beim neuen Arbeitgeber. Es liegt ein geldwerter Vorteil vor, der noch beim alten Arbeitgeber zu versteuern wäre.
Lösung: Eine Versteuerung des geldwerten Vorteils aus März beim alten Arbeitgeber hätte für den Mitarbeiter nur Nachteile bedeutet und unnötigen administrativen Aufwand verursacht (Koordination mit alten Arbeitgeber, Lohnsteuerklasse 6 usw.). Somit Versteuerung des geldwerten Vorteils beim neuen Arbeitgeber im März. Um Nutzungsgewährung (Kosten) und Nutzung wieder in den gleichen Monat und zum selben Arbeitgeber zu bringen, stellte der vorherige Arbeitgeber die Leasingrate März in Rechnung.
Wie man hieran sieht ,gibt es im Bereich der Dienstwagenversteuerung viele Varianten und Prüfthemen – es heißt hier immer auf dem aktuellen Rechtsstand zu sein.
Autorin: Sabine Katzmair, Payroll Management & Consulting März 2017